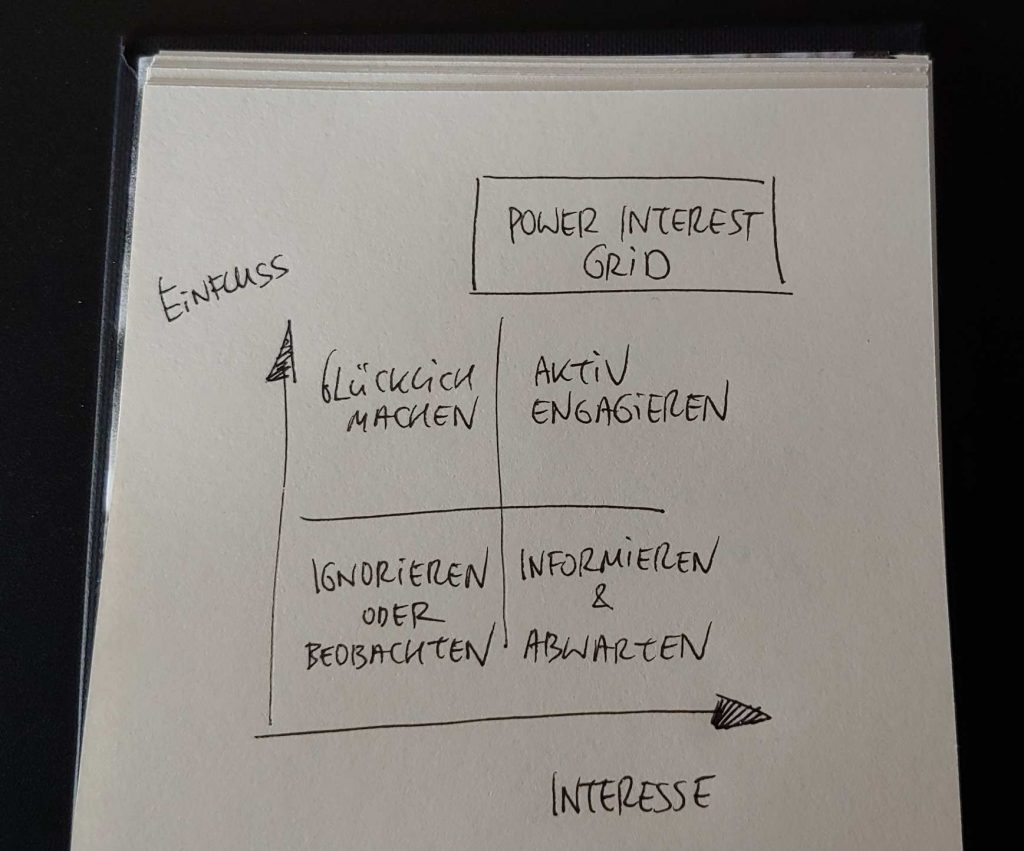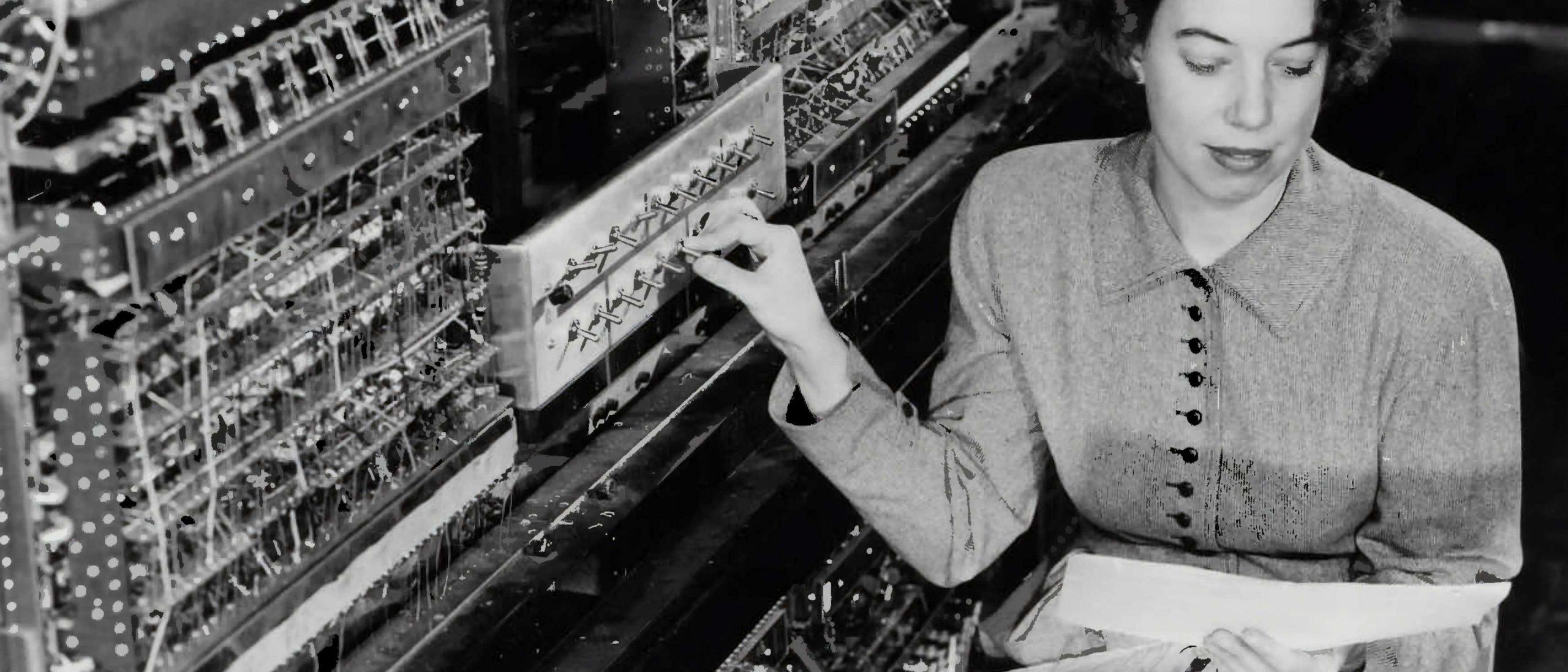„Zu wissen, was Du willst, anstatt unterwürfig zu allem Ja und Amen zu sagen, von dem dir die Welt vorschreibt, dass du es wollen sollst, bedeutet, dass du deine Seele lebendig gehalten hast.“
―Robert Louis Stevenson (Quelle)
Sebastian Pichler
Was macht dich glücklich? Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass einige Dinge dich nicht so glücklich machen, wie du es erwartet hättest? Das Auto, an das du dich sehr schnell gewöhnt hast? Dein Haus, das für dich mittlerweile selbstverständlich ist?
Sportliche und berufliche Leistungen, die schneller vergessen sind, als es zu erwarten war? Und vielleicht erinnerst du dich auch an gefürchtete Momente, die im Nachhinein gar nicht so schlimm waren? Im folgenden Beitrag möchte ich mit dir teilen, warum wir das Glück nicht immer dort finden, wo wir es erwarten.
WEGE ZUM GLÜCK
Jeder von uns strebt nach Glück auf seine eigene Art und Weise. Wie versuchst du zum Glück zu gelangen? Vielleicht möchtest du dir jetzt ein paar Sekunden Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Denn viele Entscheidungen die wir in unserem Leben treffen, werden auch durch unser Streben nach Glück mitbestimmt.
Möchte ich ein Jurist, Mauerer, Künstler oder Sportler werden? Wird mich der Beruf auf Dauer erfüllen und glücklich machen können? Mit welchem Partner möchte ich zusammen sein, welcher Partner kann mich glücklich machen? Was muss ich noch ausprobieren, damit ich am Ende des Lebens glücklich bin? Welche Art von Urlaub macht mich glücklich?
BLICK IN DIE ZUKUNFT
Natürlich können wir nicht mit Sicherheit wissen, was die beste Entscheidung wäre, aber wir probieren es vorherzusagen. Vor jeder Entscheidung versuchen wir zu erraten, wie wir uns fühlen werden, wenn wir eine Entscheidung treffen. Das passiert ganz automatisch, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen müssen.
Ein paar Beispiele: Wie werde ich mich fühlen, wenn ich im Lotto gewinne? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich erfahre, dass mein Partner mich betrügt? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich ein Eis esse? Das Gefühl kommt blitzschnell – ein Lottogewinn wäre großartig, das Betrügen des Partners würde einen niederschlagen und das Eis wäre super.
So können wir unsere Reaktion auf Dinge antizipieren, die wir vielleicht noch nicht einmal erlebt haben: Wie würdest du dich fühlen, wenn du unbekleidet durch eine Einkaufspassage laufen müsstest? Diesen Prozess bezeichnen wir als emotionale Vorhersage | affective forecasting (Wilson & Gilbert, 2003).

Innerlich fragen wir uns meist: Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache?
KEIN PERFEKTES SYSTEM
Zuerst die gute Nachricht. Wir sind gut darin, zu unterscheiden, ob unsere Entscheidungen zu angenehmen oder unangenehmen Gefühlen führen werden. Wir können also problemlos vorhersagen, ob ein Lottogewinn angenehm und ob ein Jobverlust unangenehm ist.
Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Unsere Vorhersagen zur Stärke (wie stark wird das Gefühl sein) und Dauer (wie lang wird das Gefühl andauern) unserer Gefühle ist nicht besonders gut. Mit anderen Worten, wir schätzen zwar richtig ein, dass ein Lottogewinn sich toll anfühlt, überschätzen dabei aber, wie intensiv das Gefühl sein wird – das Gefühl wird nicht so stark sein, wie wir es vermuten.
Zusätzlich überschätzen wir, wie lange das Gefühl andauern wird – das Gefühl wird ziemlich schnell wieder abklingen (Wilson & Gilbert, 2003).
UNTERSCHÄTZTE STÄRKE
Was ist, wenn wir diese Frage Menschen stellen, die ihre Beine verloren oder eine positive HIV Diagnose bekommen haben? Schwer zu glauben, aber auch in diesen Fällen ist das Muster identisch.
Kurz nach der Diagnose sind die Menschen mit schweren Krankheiten untröstlich und können sich nicht vorstellen, dass sie ihr Leben jemals wieder werden genießen können. Doch auch bei ihnen normalisiert sich der Zustand im Laufe der Zeit und auch sie werden wieder glücklicher.
Und das betrifft nicht nur Krankheiten: auch sportliche Niederlagen sind schneller aus der Welt, als Sportler das ahnen; über persönliche Beleidigungen wächst wieder neues Gras und die Sicht auf unerwartete Schwangerschaften ändert sich zum Positiven (Wilson, Wheatley, Meyers, Gilbert, & Axsom, 2000).

Wir sind stärker als wir glauben. Jeder von uns ist in der Lage, Krisen zu meistern.
PSYCHO – IMMUNSYSTEM
Sehen wir uns kurz an, warum das so ist. Wir haben ein psychologisches Immunsystem, das dafür sorgt, dass die Intensität unserer Gefühle gesenkt wird. Das erklärt beispielsweise warum Liebesgefühle im Laufe einer Beziehung an Intensität verlieren und nach einer Zeit nicht mehr so intensiv sind.
Diese Prozesse laufen unbewusst ab und tragen dazu bei, dass Erlebtes für uns leicht verdaulich wird. Tolle Ereignisse verlieren für uns schneller an Bedeutung, als wir glauben.
Das Schöne daran ist, dass auch schlimme Ereignisse für uns schneller an Bedeutung verlieren, als wir glauben. Die Dinge sind selten so angenehm oder so unangenehm wie wir uns das vorher ausmalen.
BEWUSSTER ENTSCHEIDEN
Wir haben gesehen, dass unsere Vorstellung von Glück nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen muss. Die Mechanismen, die dafür verantwortlich sind, lassen sich nicht abschaffen, denn sie sind ein Teil von uns und dienen unserem Schutz.
Dieses Wissen können wir aber nutzen, um weisere Entscheidungen zu treffen. Wird mich das große, teure Haus wirklich glücklicher machen als eine kleine, bezahlbare Wohnung? Wird mich mein eigenes Auto wirklich glücklicher machen als die Nutzung eines Carsharing Portals?
Ist die Reise nach Indien wirklich notwendig, um mich glücklich zu machen? Wird mich die schlankere Taille wirklich wesentlich glücklicher machen, als ich es jetzt schon bin? Welche kleinen Dinge können mich vielleicht glücklicher machen, als ich bisher gedacht hatte? Und zum Schluss gibt es noch einige bewährte Anregungen aus der Glücksforschung.
ERLEBE ODER KAUFE ERFAHRUNGEN, STATT OBJEKTE
Dinge und Objekte werden dich langfristig nicht glücklich machen
(Dunn, Gibert & Wilson, 2011)



HILF ANDEREN UND SCHENKE MEHR
Wenn wir mit anderen sind oder ihnen helfen, dann macht uns das glücklicher
(Dunn, Gibert & Wilson, 2011)



ERLEBE VIELE KLEINE DINGE
Viele kleine Käufe und Erfahrungen machen uns glücklicher, alleine schon deshalb, weil wir sie häufiger machen können (Dunn, Gibert & Wilson, 2011)



QUELLEN
Dunn, E. W., Gilbert, D. T., & Wilson, T. D. (2011). If money doesn’t make you happy, then you probably aren’t spending it right. Journal of Consumer Psychology, 21(2), 115-125.
Wilson, T. D., & Gilbert, D. T. (2003). Affective forecasting. Advances in Experimental Social Psychology, 35 (35), 345-411.
Wilson, T. D., Wheatley, T., Meyers, J. M., Gilbert, D. T., & Axsom, D. (2000). Focalism: a source of durability bias in affective forecasting. Journal of Personality and Social Psychology, 78 (5), 821.
Lust auf mehr?
Alles eine Frage der Balance