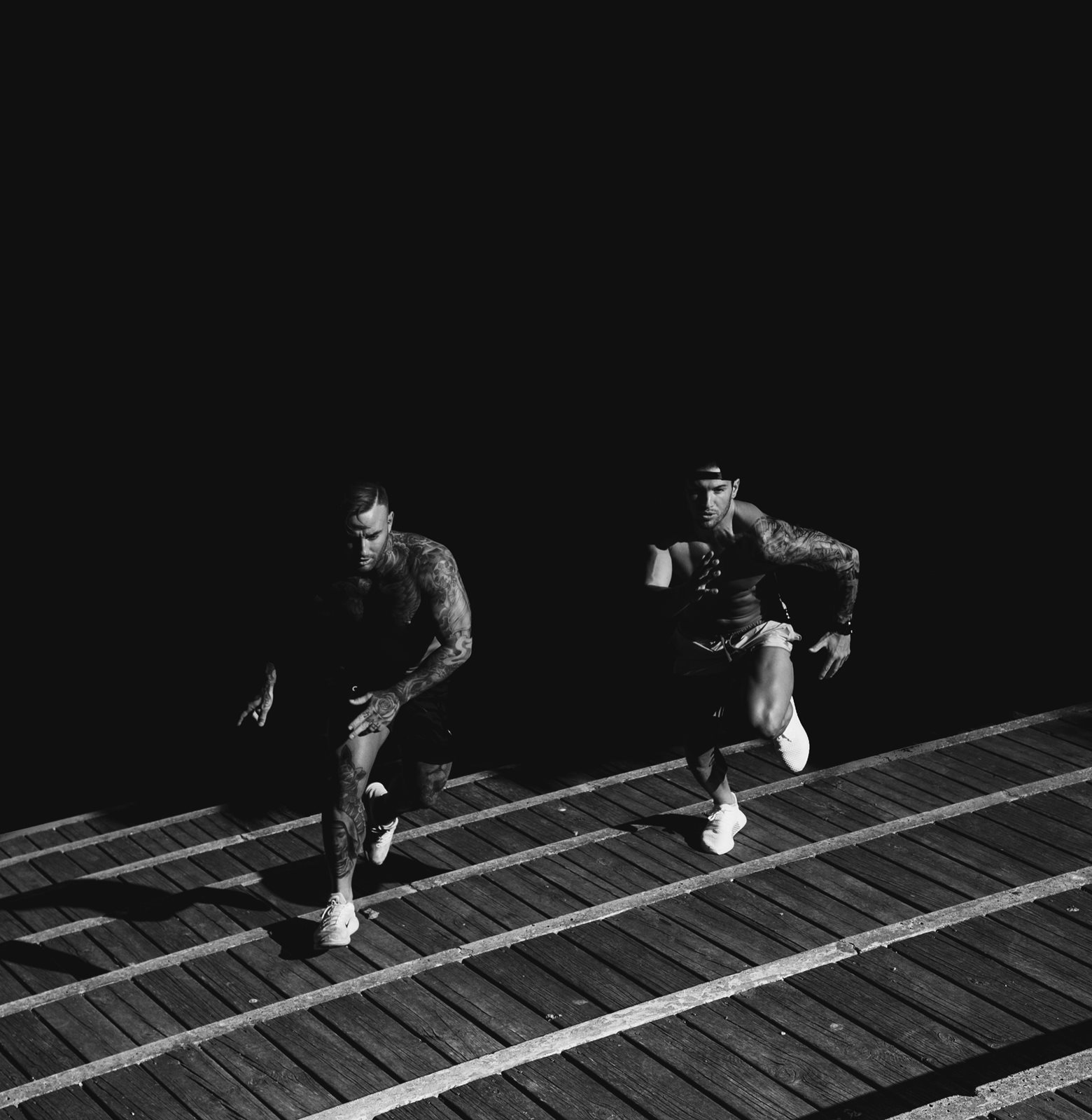Dank für das Foto geht an pina messina
Placebo ist Vielen als Scheinmedizin bekannt. Der Arzt verschreibt eine Tablette gegen Kopfschmerzen und diese verschwinden, obwohl die Tablette keine Heilmittel enthält (1). Dürfen Ärzte solche Tabletten verschreiben?
Unwirksame Pillen
Eigentlich nicht, aber in diesem Artikel (2) geben 88% der bayerischen Ärzte an, Placebos zu nutzen, also Zuckerpillen oder Vitaminpillen. Im selben Artikel wird spekuliert, dass mehr als 50% aller Ärzte Placebos nutzen. Wenn du also mit leichten Kopfschmerzen zum Arzt gehst, dann ist es möglich, dass du unwirksame Pillen bekommst. Die Ärzte dürfen solche Scheinmedikamente aber nur verschreiben, wenn du keine ernsthafte Erkrankung hast. Mehr Infos zum Placebo in der Medizin gibt’s unter diesem Link.
Placebos im Sport
Wie würde es bei einem Placebo im Sport aussehen? Würde eine Kraftpille meine Leistung steigern, auch wenn es keine Kraftpille wäre? Zum Beispiel beim Stemmen von Gewichten.
Placebos beim Bankdrücken kamen in der Studie von Kalasountas, Reed und Fitzpatrick (2007) zum Einsatz. Zuerst wurde geschaut, wie viel Gewicht die Person im Standardtraining heben kann. Dann wurden zwei Gruppen gebildet. Der Placebogruppe wurde gesagt, dass sie eine leistungssteigernde Tablette bekommt, die aus angereicherten Aminosäuren besteht.
Der Kontrollgruppe wurde mitgeteilt, dass sie eine Tablette aus Zucker und Milch bekommt. Beide Gruppen bekamen natürlich identische Tabletten, die aus Zucker waren und keine bedeutende Wirkung auf Leistung haben. Anschließend wurde wieder Gewicht gestemmt. Im Vergleich zu der Kontrollgruppe, verbesserte sich die Kraftleistung der Placebogruppe deutlich. Für die Statistikfreunde unter uns – der Effekt war auf einem Niveau von p < .01 signifikant.
Zum Ende wurde den Personen noch mitgeteilt, dass sie getäuscht wurden und die Pillen doch keine leistungssteigernden Mittel enthalten. Beide Gruppen bekamen noch eine Tablette und durften noch ein letztes Mal Gewicht stemmen. Die Leistung der Placebogruppe verschlechterte sich daraufhin und sank auf das Normalniveau zurück. Daraus kann man vorsichtig schließen, dass die Steigerung der Leistung eng mit dem Glauben daran verbunden war, dass eine Pille die Kraftreserven steigern kann.
Scheindoping bei Läufern
Eine weitere Forschungsarbeit wurde mit Läufern durchgeführt (Wright et al., 2009). Trainierte Läufer wurden gebeten 5 Kilometer auf Zeit zu laufen. 30 Minuten vor dem Lauf bekam die Kontrollgruppe 300 ml normales Wasser und der Placebogruppe wurde 300 ml Super-Wasser verabreicht. Auf der Flasche stand entweder „Water“ oder „Super-oxygenated water“. Die Personen aus der Placebo-Gruppe liefen um 6,5% schneller als die Kontrollgruppe.
Weniger Schmerz durch Scheinmedizin
Ein letztes Beispiel aus der Wissenschaft soll die Macht von Placebos eindrucksvoll demonstrieren (Benedetti, Pollo und Colloca, 2007). Teilnehmer nahmen an einem Schmerztest teil, es wurde geschaut wie viel Schmerz sie aushalten können. Insgesamt gab es drei Schmerztests an drei aufeinanderfolgenden Wochen. Die ersten zwei Wochen wurde der Placebogruppe Morphin gegeben, damit sie den Schmerz länger ertragen kann. In der dritten Woche wurde ein Placebo statt Morphin verabreicht – der Person wurde allerdings versichert, dass es Morphin ist. Obwohl die Person kein Präparat erhielt, konnte sie den Schmerz ziemlich lang aushalten. Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass Placebos auch als Doping eingesetzt werden können (6).
Wie man´s machen kann: Beim Training wird dem Sportler Doping verabreicht, er wird darauf konditioniert zu glauben, dass sich seine Leistung steigert wenn er eine Spritze oder Tablette bekommt. Unmittelbar vor dem Wettkampf bekommt er dagegen nur ein Placebo. Wenn der Sportler keine Zweifel hat, dass es Doping ist das er bekommt, dann wird sich seine Leistung wahrscheinlich steigern und das ganz legal.
„Der Glaube steigert die Leistung“ – so kann man die Wirkung von Placebos grob zusammenfassen. Logischerweise ist der Effekt von Placebos kleiner wenn die Person vermutet, dass sie eine Pille bekommt, die nichts enthält. Natürlich ist der Placeboeffekt nicht bei allen Krankheiten, Störungen und Problemen gleichermaßen stark – mehr dazu hier (Geers et al., 2007). In der aktuellen Metaanalyse von Köteles et al. (2011) wird der Placeboeffekt im Sport im Mittel auf .40 geschätzt (95% Konfidenzintervall .24 – .56).
Kurz gefasst:
- Der Placeboeffekt existiert im Sport und hat eine geringe bis mittlere Stärke
- Für das Auftreten des Effekts muss die Person an die Effektivität des Placeboobjektes glauben (Pille, Spritze, Pulver)
- Leider können wir uns selbst kein Placebo verabreichen, weil wir wissen, dass es nur ein Placebo ist. Das könnten Trainer machen und da stellt sich die Frage, wann eine Täuschung der Athleten ethisch und sinnvoll ist
Macht des Glaubens und Aberglaubens
Der Glaube an ein Placebo und der Aberglaube haben einige Gemeinsamkeiten. An beides glaubt man – im Fall des Placebo ist es etwas Spürbares, Fassbares, Konkretes. Aberglaube dagegen ist rein spekulativ und hat eher mit Vorstellung und Einbildung zu tun. Wir werfen noch einen Blick auf die Handlungen von Profisportlern, die ihren Glauben ausdrücken.
Der Quarterback der Buffalo Bills (American Football), Jim Kelly, zwang sich vor jedem Spiel zu kotzen. Der Pitcher der New York Nets (Baseball), Turk Wendell, putzte sich zwischen den Innings (Spielabschnitten) die Zähne (Vyse, 2013).
Manche tragen ihre Glücksbringer mit sich, wie das häufig bei Soldaten ist. Im Krieg haben viele Soldaten eine Bibel über ihrem Herzen angenäht, in der Hoffnung, dass die Bibel sie vor Verletzungen und dem Tod schützt. Patronenhüllen mit dem eigenen Namen sollen beispielsweise Glück im Kampfgeschehen bringen (10).
Der Eishockeyspieler Wayne Gretzky, Spitzname THE GREAT ONE, gilt als einer der besten Eishockeyspieler aller Zeiten und ist für seinen Aberglauben bekannt (11). So hat er nach dem Aufwärmen seine Getränke immer in dieser Reihenfolge getrunken: Diät Cola, Wasser, Gatorade, Diät Cola. Vor seinen Spielen hat er auch Babypuder auf seinen Schläger gestreut.
Viele erfolgreiche Sportler sind abergläubisch, aber es gibt mindestens genauso viele Erfolgreiche die es nicht sind. Sie sind nicht so erfolgreich weil sie abergläubisch sind. Vielleicht sind sie eher abergläubisch, weil sie erfolgreich sind.
Quellen
(1) https://de.wikipedia.org/wiki/Placebo
(2) http://www.t-online.de/lifestyle/gesundheit/id_44723260/arzneimittel-jeder-zweite-arzt-verordnet-placebos-.html
(3) http://www.igm-bosch.de/content/language1/downloads/Placebo_LF_1_17012011.pdf
(4) Kalasountas, V., Reed, J., & Fitzpatrick, J. (2007). The effect of placebo-induced changes in expectancies on maximal force production in college students. Journal of Applied Sport Psychology, 19(1), 116-124.
(5) Wright, G., Porcari, J. P., Foster, C. C., Felker, H., Koshololek, A., Otto, J., … & Udermann, B. (2009). Placebo effects on exercise performance. Gundersen Lutheran Medical Journal, 6(1), 3-7.
(6) Benedetti, F., Pollo, A., & Colloca, L. (2007). Opioid-mediated placebo responses boost pain endurance and physical performance: is it doping in sport competitions?. The Journal of Neuroscience, 27(44), 11934-11939 .
(7) Geers, A. L., Kosbab, K., Helfer, S. G., Weiland, P. E., & Wellman, J. A. (2007). Further evidence for individual differences in placebo responding: an interactionist perspective. Journal of psychosomatic research, 62(5), 563-570.
(8) Köteles, F., Bárdos, G., Bérdi, M., & Szabó, A. (2011). Placebo effects in sport and exercise: a meta-analysis. European Journal of Mental Health, (02), 196-212.
(9) Vyse, S. A. (2013). Believing in Magic: The Psychology of Superstition-Updated Edition. Oxford University Press.
(10) http://newworldwitchery.com/2014/05/26/blog-post-190-some-military-superstitions/
(11) https://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_Gretzky